Arbeitsdruck steigt – Studieren zunehmend unmöglich
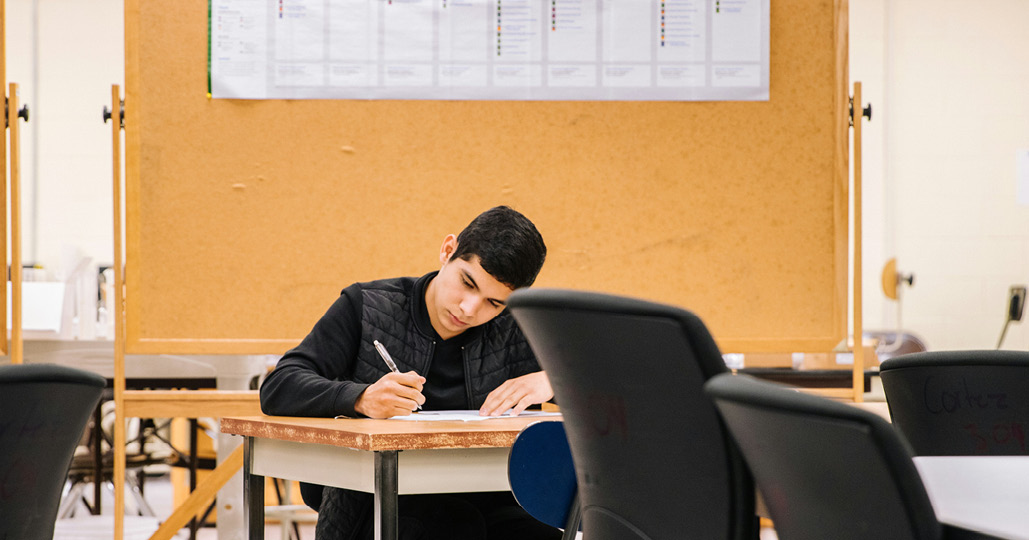
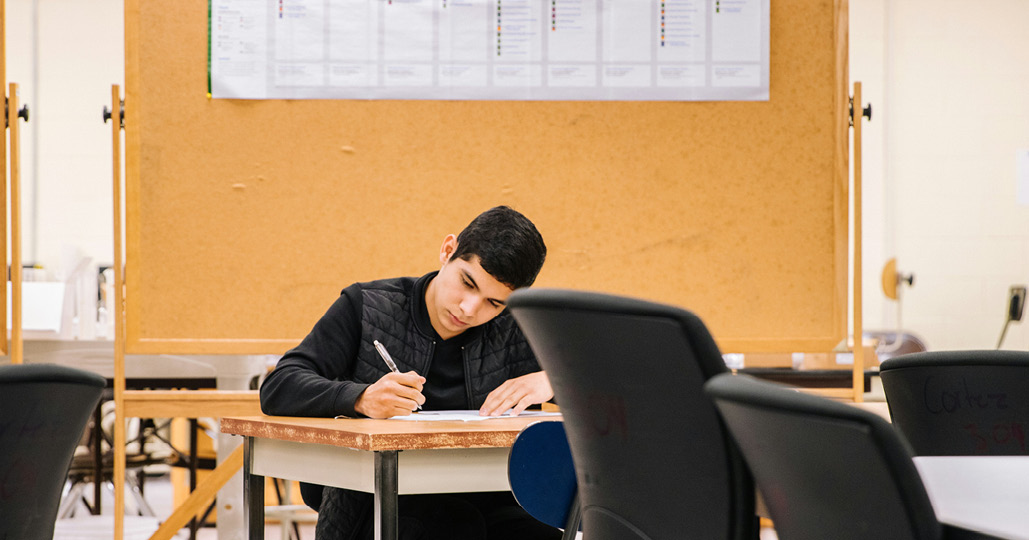
Medien und Politik zeichnen ein Bild von faulen Studierenden, die dem Steuerzahler nur unnötig auf der Tasche liegen. Wie jedoch die Realität der Studierenden aussieht, zeigt die Studierenden-Sozialerhebung aus dem Jahr 2023. Von Valentin Starlinger
Studieren ist ein Vollzeitjob. Studierende ohne Erwerbstätigkeit wenden im Schnitt 37 Stunden pro Woche für das Studium auf. Wie die Studie feststellt, wirkt sich schon ein Erwerbsausmaß von 9 Wochenstunden merklich negativ auf den Studienaufwand aus. 58% der erwerbstätigen Studierenden bewerten die Vereinbarkeit von Studium und Arbeit als schwierig.
Dennoch müssen 69% der Studierenden neben dem Studium arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten – ein Anstieg um vier Prozentpunkte im Vergleich zu 2019. Die durchschnittliche Erwerbstätigkeit beträgt 21 Wochenstunden.
Dieser Trend geht vor allem auf die steigenden Lebenshaltungskosten zurück: Fast 40 Prozent des Budgets entfallen auf Miete, weitere 20 Prozent auf Lebensmittel. Die Erwerbstätigkeit der Studierenden finanziert vor allem Miethaie und Supermarktketten.
Gerade einmal 55% aller arbeitenden Studierenden geben an, dass ihre Erwerbstätigkeit einen inhaltlichen Bezug zu ihrem Studium hat. Das beinhaltet jedoch berufsbegleitende Studien oder vollzeitarbeitende Langzeitstudierende. Die Erwerbstätigkeit dient also nicht der praktischen Ergänzung des Studiums, sondern ist, wie 72% der erwerbstätigen Studierenden angeben, „zur Bestreitung meiner Lebenshaltungskosten unbedingt notwendig.“
Verschärft hat diese Entwicklung die Inflation. Eltern konnten keine zusätzliche finanzielle Unterstützung bieten. Fast der komplette Inflationsdruck musste also selbst getragen werden.
Diese durchschnittlichen Zahlen sind jedoch nur die Spitze des Eisberges. Denn Studierende sind eine sehr durchmischte Gruppe. Die Studie hebt hervor, dass v.a. Studierende, deren Eltern nicht studiert haben, arbeiten gehen müssen. Erwerbstätigkeit mit sinnvollem Bezug zum Studium gehen insbesondere jene Studierende nach, die keine finanzielle Schwierigkeiten haben.
Der freier Hochschulzugang hat nie bedeutet, dass jeder ernsthaft studieren kann. Die finanzielle und praktische Unterstützung, die die eigenen Eltern geben können, ist zentral – und damit ihr Einkommen und Bildungsniveau. Insbesondere Österreich ist bekannt als Land, in dem Bildungsabschlüsse „vererbt“ werden.
Dass die Zahl der Studierenden an öffentlichen Universitäten seit 10 Jahren kontinuierlich abnimmt, ist nicht überraschend, sondern eine direkte Konsequenz der Krise des Kapitalismus, welcher den Zugang zur Bildung zunehmend verengt.
Die neue Regierung plant aus der Not eine Tugend zu machen: Fachhochschulen sollen stark gefördert werden, um schnell und effizient Fachkräfte für den Arbeitsmarkt zu produzieren. An den Universitäten soll wieder Exzellenzförderung betrieben werden. Das beschränkt sich auf jene, die das finanzielle Privileg haben, genug Zeit fürs Studium aufzuwenden. Für alle anderen soll an den Unis kein Platz mehr sein.